
Inhalt
Rechte und Schutz der begünstigten Behinderten
Sozial- und Behindertenpolitik
Behindertenvertretung (Grundlagen)
Behindertenvertretung (Praxis)
Für den Inhalt verantwortlich:
Bernhard Hampl

Inhalt
Rechte und Schutz der begünstigten Behinderten
Sozial- und Behindertenpolitik
Behindertenvertretung (Grundlagen)
Behindertenvertretung (Praxis)
Für den Inhalt verantwortlich:
Bernhard Hampl

Hier werden im allgemeinen nur Förderungen betrachtet, die auf bundesweiten (gesetzlichen) Regelungen beruhen. Daneben gibt es auch noch Förderungen durch die Bundesländer, etwa in Wien durch den Fonds Soziales Wien (FSW), der auf seiner Homepage über seine Förderrichtlinien informiert.
Die Förderungen, die Arbeitgebern bei der Beschäftigung oder Ausbildung von Behinderten gewährt werden, kommen natürlich auch den Behinderten zugute. Es gibt aber auch Förderungen, die Behinderten direkt gewährt werden.
| Jedem Behinderten, der eine öffentliche Förderung in Anspruch nehmen möchte, ist dringend anzuraten, vorher eine Beratung beim Sozial-Service des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) einzuholen. Das Sozialministeriumservice ist nämlich nach § 14 Abs. 2 BBG verpflichtet, Behinderten und von konkreter Behinderung bedrohten Menschen Hilfe anzubieten, wenn sie ihre Schwierigkeiten aus eigener Kraft nicht meistern können (und wer kommt schon „aus eigener Kraft“ durch den Förderdschungel). Diese Hilfe hat alle Sach- und Rechtsfragen zu umfassen, die im Zusammenhang mit der Behinderung von Bedeutung sind. Insbesondere hat dieses Sozial-Service Hilfestellung in folgenden Fällen zu gewähren: | |
|
|
bei der Aufklärung über die nach den einschlägigen Gesetzen bestehenden Rechte und Pflichten, |
|
|
bei der Vermittlung an die zuständigen Stellen, |
|
|
bei der Unterstützung bei der Erlangung von Hilfen, |
|
|
bei der Beratung über Hilfsmittel |
|
|
bei der Vermittlung der Inanspruchnahme aller Arten der Hilfe aus der freien Wohlfahrt. |
| (§ 15 BBG). | |
Da dies meines Wissens eine der wenigen Stellen im Behindertenrecht ist, wo Behinderten ein Rechtsanspruch gewährt wird, sollte man bei Bedarf nicht zögern, diese Hilfe auch in Anspruch zunehmen. Außerdem ist das Sozialministeriumservice verpflichtet, Anträge und Eingaben unverzüglich an die zuständigen Stellen weiterzuleiten, was Behördenwege sehr erleichtern kann. Erfahrungsgemäß hilft das Sozialministeriumservice im allgemeinen auch gerne und effektiv. Diese Hilfe sollte sogar auch außerhalb des Sitzes des Sozialministeriumservice angeboten werden, und zwar in der Form mobiler Beratungsdienste (§ 14 Abs. 4 BBG). Hinweise auf diesen Dienst finden sich auf der Homepage des Sozialministeriumservice aber keine.
Die Beratung durch das Sozialministeriumservice wird auch aus dem Grund effektiv sein, weil seine „Organe“ nach dem Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) der Amtshaftung unterliegen: „Der Bund, die Länder, die Gemeinden und die sonstigen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts haften für den Schaden, den die als ihre Organe handelnden Personen in Vollziehung der Gesetze durch ein rechtswidriges Verhalten wem immer schuldhaft zugefügt haben.“ (Art. 23 Abs. 1 B-VG). Und analog das Amtshaftungsgesetz (AHG): „Der Bund, die Länder, die Gemeinden, sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts und die Träger der Sozialversicherung - im folgenden Rechtsträger genannt - haften nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts für den Schaden am Vermögen, den die als ihre Organe handelnden Personen in Vollziehung der Gesetze durch ein rechtswidriges Verhalten wem immer schuldhaft zugefügt haben; den Geschädigten haftet das Organ nicht. Der Schaden ist nur in Geld zu ersetzen.“ (§ 1 Abs. 1 AHG). Es haftet also nicht der einzelne Beamte des Sozialministeriumservice, das Organ, sondern das Sozialministeriumservice, der Rechtsträger selber, für die Richtigkeit von Auskünften. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann der Rechtsträger aber von seinem Organ Rückersatz verlangen (§ 3 Abs. 1 AHG).
Dazu sagt der Rechtssatz RS0113363 aus dem Erkenntnis 1 Ob 14/06s vom 22.2.2000: „Behördenauskünfte bezwecken den Dispositionsschutz. Danach sollen Auskünfte wirtschaftliche Dispositionen erleichtern oder überhaupt erst sinnvoll ermöglichen und deren beabsichtigte Verwirklichung sichern. Das ist nur erreichbar, wenn die nach dem Auskunftsbegehren erteilte Information richtig ist. Der Auskunftsanspruch bezieht sich auf eine der Sache nach richtige Information. Der allfällige Ausgleich eines reinen Vermögensschadens infolge des durch eine Fehlinformation vereitelten Dispositionsschutzes ist durch die Gewährung von Schadenersatz realisierbar. Ein solcher Ersatz ist nach dem Amtshaftungsgesetz zu leisten, wenn eine falsche oder unzureichende, schadensursächliche Auskunft als fehlerhafter Hoheitsakt zu qualifizieren ist.“
Verfahren wegen Amtshaftung sind allerdings nicht leicht zu führen und sollten nach Möglichkeit mit einem Rechtsbeistand unternommen werden.
Zum Unterschied zwischen Schulung und Ausbildung siehe den Abschnitt über Schulungskosten und Ausbildungsbeihilfen für Arbeitgeber.
2.1 Schulungskosten (Punkt 8.1
der Richtlinie vom 1.7.2012 für
„Individualförderungen
zur Beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderung“,
GZ: 44.101/0037-IV/A/6/2012)
Bei einem bestehenden Beschäftigungsverhältnis wird für
Schulungen im allgemeinen der Arbeitgeber verantwortlich sein (siehe
den entsprechenden Abschnitt für
Arbeitgeber). Für begünstigte Behinderte selber werden
Schulungskosten nur insoweit übernommen, als „diese zur
beruflichen Integration notwendig sind und nachweislich nicht von
anderen Stellen getragen werden“ (Punkt 8.1 Abs. 1 der
Richtlinie „Individualförderungen“).
Wie aber soll ein arbeitsloser Behinderter nachweisen, daß
er mit einer bestimmten Schulung einen Arbeitsplatz bekommen wird? Auch
eine Einstellungszusage eines bestimmten Arbeitgebers ist ja keine
Garantie dafür, daß nicht etwa ein anderer Arbeitgeber den
Behinderten ohne diese Schulung einstellen würde.
| 2.2 Ausbildungsbeihilfen (Punkt 8.2 der Richtlinie vom 1.7.2012 für „Individualförderungen“) | |
| Einfacher ist die Situation bei den Ausbildungsbeihilfen. Für den behinderungsbedingten Mehraufwand im Rahmen einer Schul- oder Berufsausbildung können für Menschen mit Behinderung mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 Prozent sowie für Jugendliche mit einem Grad der Behinderung von mindestens 30 Prozent, die sich in einer integrativen Berufsausbildung befinden (§ 8b Abs. 13 des Berufsausbildungsgesetzes), Ausbildungsbeihilfen gewährt werden. Voraussetzung dafür ist, daß diese Personen | |
|
|
eine im § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 oder eine im § 1b des Schülerbeihilfengesetzes 1983 genannte Unterrichtseinrichtung besuchen oder |
|
|
an einem Vorbereitungslehrgang für die Studienberechtigungsprüfung teilnehmen oder |
|
|
in Lehrausbildung stehen oder |
|
|
Schüler/innen in Ausbildung zum Krankenpflegefachdienst oder in Ausbildung in einer Hebammenlehranstalt sind oder |
|
|
nach Beendigung der Pflichtschule bzw. nach der Absolvierung der Schulpflicht in einer weiterführenden Schule eine Schul- oder Berufsausbildung in einer Unterrichts- oder Ausbildungseinrichtung absolvieren, deren Zeugnisse staatlich anerkannt werden oder |
|
|
im Ausland in einer vergleichbaren Schul- oder Berufsausbildung stehen. |
Zur Abgeltung des behinderungsbedingten Mehraufwandes kann für die Dauer der Schul- oder Berufsausbildung eine monatliche Beihilfe in Höhe der Ausgleichstaxe für Unternehmen mit 25 bis 99 Mitarbeitern geleistet werden (im Jahr 2017 sind das 253 EUR). Der behinderungsbedingte Mehraufwand ist vom Antragsteller glaubhaft zu machen. Bei nachweisbar höheren Kosten können diese bis zur Höhe der dreifachen Ausgleichstaxe monatlich (also 759 EUR im Jahr 2017) ersetzt werden.
Beihilfen zur Abdeckung des behinderungsbedingten Mehraufwandes während der Absolvierung eines Studiums können für die gesetzlich vorgesehene Dauer des Studiums zuzüglich der für den Bezug von Studienbeihilfe zulässigen weiteren Semester gewährt werden. Das sind nach § 19 Abs. 3 Z. 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 zwei Semester bei einem Grad der Behinderung von mindestens 50 %; nach der Verordnung BGBl. II Nr. 310/2004 betreffend die Gewährung von Studienbeihilfe für behinderte Studierende ist eine zusätzliche Verlängerung je nach Art der Behinderung zulässig.
Antragsformular für eine Ausbildungsbeihilfe
Zuschüsse für Förderungen fallen jetzt in die Zuständigkeit des Arbeitsmarktservice, das auf seiner Homepage aber nur spärlich Auskunft gibt.
Zum Ausgleich behinderungsbedingter Leistungseinschränkungen bzw. der Optimierung der Leistungsfähigkeit können bauliche, technische und ergonomische Adaptierungsmaßnahmen gefördert werden. Während bauliche Maßnahmen am Arbeitsplatz (wie Treppenlifte oder Behindertenparkplätze) dem Arbeitgeber gewährt werden (siehe den entsprechenden Abschnitt 4 für Arbeitgeber), werden Hilfsmittel, die personenspezifisch sind und von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz mitgenommen werden können (wie ein behinderungsspezifischer Bürostuhl oder eine Braille-Zeile) eher dem Arbeitnehmer gewährt werden.
In Punkt 5 Abs. 3 der Richtlinie für „Individualförderungen“ wird die Förderung von technischen Arbeitshilfen geregelt: „Zur Beschaffung und Instandsetzung von unmittelbar mit der Berufsausübung im Zusammenhang stehenden, die Behinderung ausgleichenden technischen Arbeitshilfen sowie zur Ausbildung im Gebrauch dieser Arbeitshilfen können die Kosten bis zur vollen Höhe übernommen werden.“ Die Preisangemessenheit ist durch Vergleichsangebote nachzuweisen.
So wie bei den Lohnkostenzuschüssen sind öffentliche Rechtsträger von Förderungen für technische Arbeitshilfen ausgeschlossen. Behinderte Unternehmer können dagegen Förderungen für technische Arbeitshilfen erhalten.
Unter „http://www.hilfsmittelinfo.gv.at“ stellte das Sozialministerium früher eine Hilfsmittel-Datenbank zur Verfügung, wo das breite Spektrum technischer Hilfsmittel, mit denen sich Behinderungen vieler Arten ausgleichen lassen, objektiv dargestellt wurde. Dieser Dienst scheint eingestellt worden zu sein. Jedenfalls finden sich nirgendwo aktive Links auf diese Datenbank. Auch die Umsetzungsregelungen Technische Assistenz des Sozialministeriumservice enthalten keinen Hinweis darauf. Hier soll an seiner Stelle auf das deutsche Pendant, die REHADAT Hilfsmittel-Datenbank, verwiesen werden.
| Für alle Mobilitätshilfen gilt, daß sie nur für begünstigte Behinderte und ihnen Gleichgestellte gewährt werden. Den begünstigten Behinderten gleichgestellt sind solche Behinderte, die wegen der Ausschlußbestimmungen des § 2 BEinstG zwar keine begünstigten Behinderten sind, die aber | |
|
|
einen Grad der Behinderung von mindestens 50 % aufweisen, und die |
|
|
Unionsbürger, Staatsbürger von Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, Schweizer Bürger oder deren Familienangehörige sind, |
|
|
Flüchtlinge, denen Asyl gewährt worden ist, sind (solange sie zum dauernden Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt sind), |
|
|
Drittstaatsangehürige, die berechtigt sind, sich in Österreich aufzuhalten und einer Beschäftigung nachzugehen, soweit diese Drittstaatsangehörigen hinsichtlich der Bedingungen einer Entlassung nach dem Recht der Europäischen Union österreichischen Staatsbürgern gleichzustellen sind, |
|
|
sich nicht in Schul- oder Berufsausbildung befinden (ausgenommen Lehrlinge, Teilnehmer an einer Ausbildung zum gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege oder zur Hebamme und Praktikanten für einen eine Hochschulausbildung voraussetzenden Beruf), |
|
|
das 65. Lebensjahr noch nicht überschritten haben (außer wenn sie noch berufstätig sind), |
|
|
keine Geldleistungen wegen dauernder Erwerbs- bzw. Berufsunfähigkeit und auch keine Pensionen oder Ruhegenüsse aus dem Versicherungsfall des Alters beziehen und nicht in Beschäftigung stehen |
|
|
zumindest zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit auch auf einem geschützten Arbeitsplatz oder in einem Integrativen Betrieb in der Lage sein. |
| (Punkt 4.3 der Richtlinie „ Individualförderungen“ unter Verweis auf § 10a Abs. 2, 3 und 3a BEinstG) | |
Bei einzelnen Förderarten kommen zusätzliche Bedingungen dazu, etwa die Voraussetzung der Unzumutbarkeit der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Sie ist durch eine entsprechende Eintragung im Behindertenpaß nachzuweisen.
| 4.1 Behindertenpaß
und die Zusatzeintragung der „Unzumutbarkeit der
Benützung öffentlicher Verkehrsmittel“: Nach § 40 Abs. 1 Bundesbehindertengesetz (BBG) ist behinderten Menschen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Inland und einem Grad der Behinderung oder einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 50 Prozent auf Antrag vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (§ 45 BBG) ein Behindertenpaß auszustellen, wenn |
|
|
|
ihr Grad der Behinderung (ihre Minderung der Erwerbsfähigkeit) nach bundesgesetzlichen Vorschriften durch Bescheid oder Urteil festgestellt ist oder |
|
|
sie nach bundesgesetzlichen Vorschriften wegen Invalidität, Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit oder dauernder Erwerbsunfähigkeit Geldleistungen beziehen oder |
|
|
sie nach bundesgesetzlichen Vorschriften ein Pflegegeld, eine Pflegezulage, eine Blindenzulage oder eine gleichartige Leistung erhalten oder |
|
|
für sie erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird oder sie selbst erhöhte Familienbeihilfe beziehen oder |
|
|
sie dem Personenkreis der begünstigten Behinderten im Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes angehören. |
Nach § 41 Abs. 1 BBG gilt als Nachweis für das Vorliegen der im § 40 genannten Voraussetzungen der letzte rechtskräftige Bescheid eines Rehabilitationsträgers (§ 3 BBG), ein rechtskrüftiges Urteil eines Gerichtes nach dem Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, ein rechtskräftiges Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes oder die Mitteilung über die Gewährung der erhöhten Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 5 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967.
Nach § 45 Abs. 1 BBG sind Anträge auf Ausstellung eines Behindertenpasses, auf Vornahme einer Zusatzeintragung oder auf Einschätzung des Grades der Behinderung unter Anschluß der erforderlichen Nachweise bei dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) einzubringen.
Nach § 47 BBG ist der
Bundesminister für Arbeit und Soziales ermächtigt, mit
Verordnung die näheren Bestimmungen über den nach § 40
auszustellenden Behindertenpaß und damit verbundene
Berechtigungen festzusetzen.
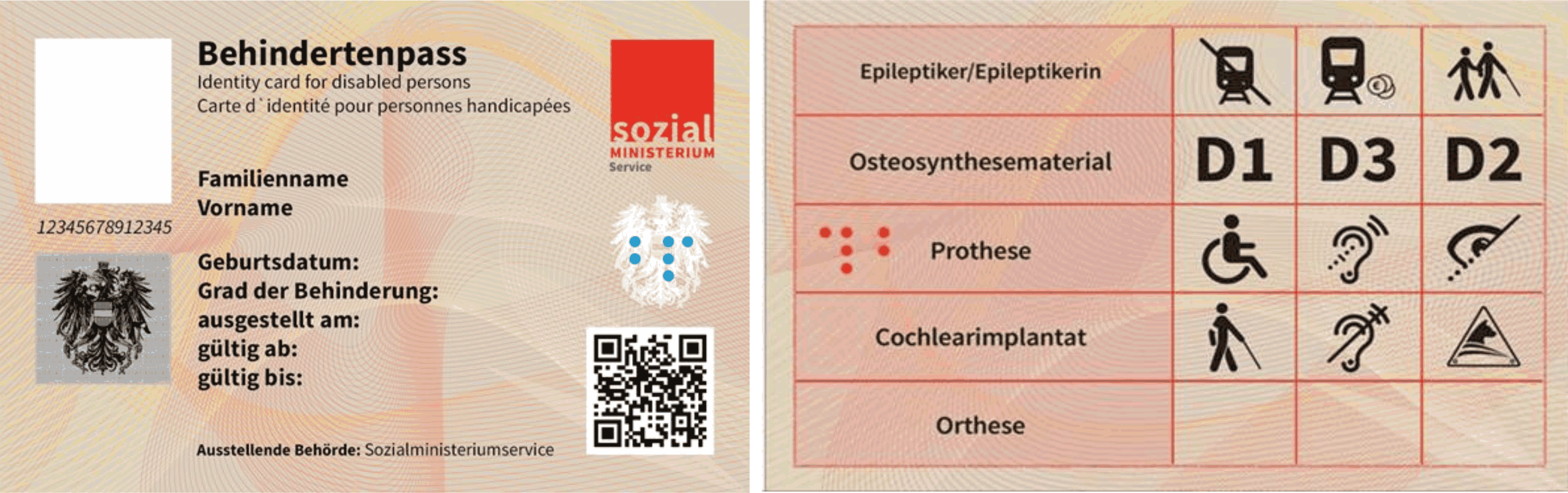 Das hat der
Sozialminister in der Verordnung über die
Ausstellung von Behindertenpässen und von Parkausweisen
getan. Das hat der
Sozialminister in der Verordnung über die
Ausstellung von Behindertenpässen und von Parkausweisen
getan.Nach § 1 Abs. 4 Z. 3 dieser Verordnung ist (bei Erfüllen der Voraussetzungen) in den Behindertenpaß einzutragen, daß der Inhaberin bzw. dem Inhaber des Passes die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung nicht zumutbar ist. Die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel ist insbesondere dann nicht zumutbar, wenn das 36. Lebensmonat vollendet ist und |
|
|
|
erhebliche Einschränkungen der Funktionen der unteren Extremitäten oder |
|
|
erhebliche Einschränkungen der körperlichen Belastbarkeit oder |
|
|
erhebliche Einschränkungen psychischer, neurologischer oder intellektueller Fähigkeiten, Funktionen oder |
|
|
eine schwere anhaltende Erkrankung des Immunsystems oder |
|
|
eine hochgradige Sehbehinderung, Blindheit oder Taubblindheit nach Abs. 4 Z 1 lit. b oder d vorliegen. |
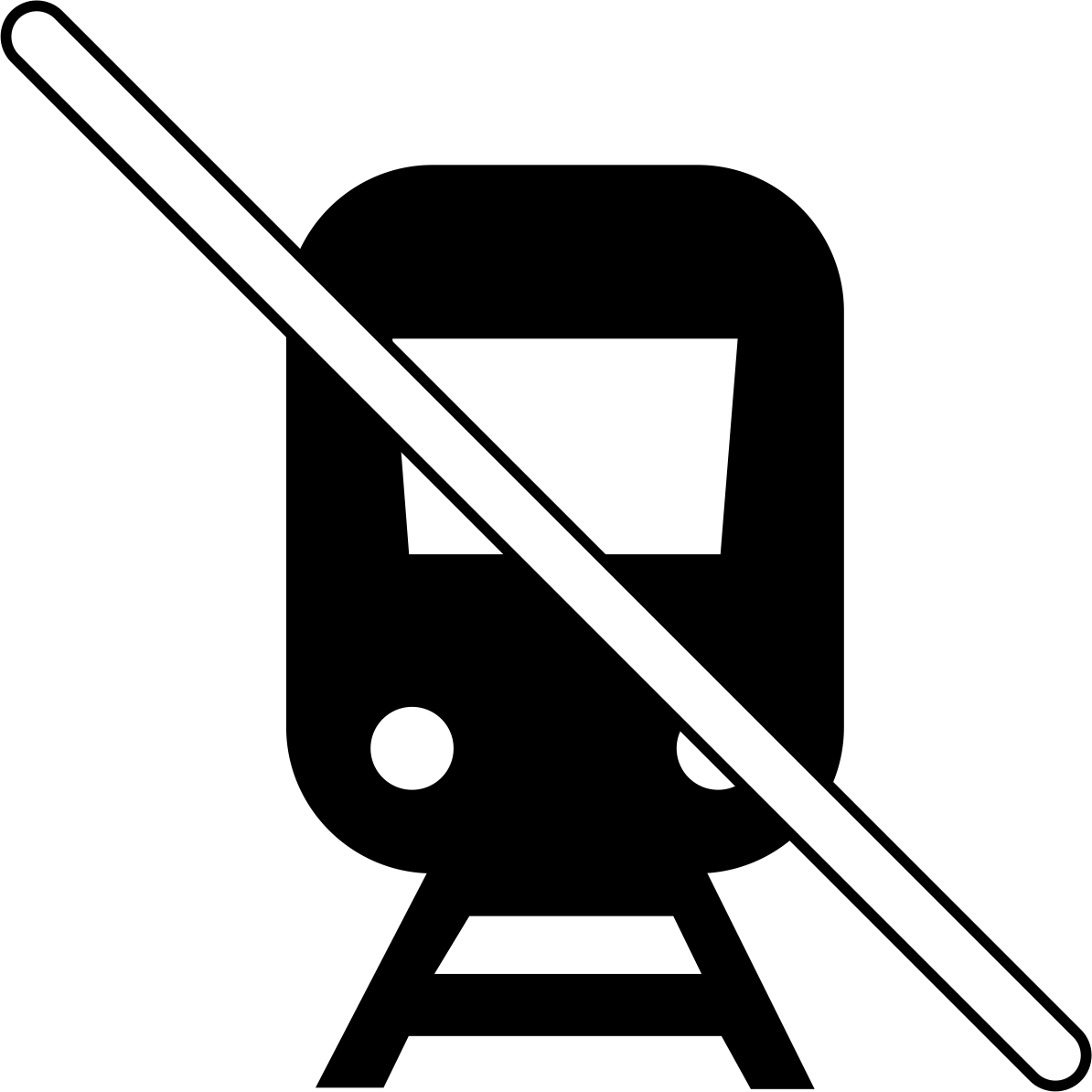 Die im Abs. 4
angeführten Eintragungen sind auf der Rückseite
entweder in Form von Piktogrammen oder in Form von
Schriftzügen vorzunehmen. Beispielsweise ist für die
Zusatzeintragung über die Unzumutbarkeit der Benützung
öffentlicher Verkehrsmittelund das links stehenden
Piktogramms zu verwenden. Die im Abs. 4
angeführten Eintragungen sind auf der Rückseite
entweder in Form von Piktogrammen oder in Form von
Schriftzügen vorzunehmen. Beispielsweise ist für die
Zusatzeintragung über die Unzumutbarkeit der Benützung
öffentlicher Verkehrsmittelund das links stehenden
Piktogramms zu verwenden. |
|
Inhaber eines Behindertenpasses mit der Zusatzeintragung der „Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel“ genießen nach § 29b Straßenverkehrsordnung (StVO) auch andere Vorteile wie etwa beim Parken und Halten oder beim Befahren von Fußgängerzonen (§ 29b Abs. 2 bis 4). Um diese Vorteile genießen zu können, muß ein „Parkausweis“ beantragt werden.
Antragsformular für einen Behindertenpaß
Antragsformular für einen Parkausweis (dem Antrag ist ein
Lichtbild im Format 3,5 × 4,5 cm beizulegen)
Falls eine Zusatzeintragung in den Behindertenpaß über die Unzumutbarkeit der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel gewünscht wird, ist zu beachten, daß diese nicht schon bei der Feststellung des Grades der Behinderung eingetragen werden kann, sondern eines eigenen Feststellungsverfahrens bedarf, wie der Verwaltungsgerichtshof im Erkenntnis vom 18.12.2006 mit der Geschäftszahl 2006/11/0211 festgestellt hat: „Der Beschwerdeführer stellte den Antrag, in den Behindertenpaß zusätzlich einzutragen, daß ihm die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel wegen dauernder Gesundheitsschädigung unzumutbar sei. Um die Frage der Zumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel beurteilen zu können, hat die Behörde zu ermitteln, ob der Antragsteller dauernd an seiner Gesundheit geschädigt ist und wie sich diese Gesundheitsschädigung nach ihrer Art und ihrer Schwere auf die Zumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel auswirkt. Dieses Beweisthema ist somit nicht identisch mit der im Rahmen eines Verfahrens nach § 14 Abs. 2 oder 5 BEinstG vorzunehmenden Einschätzung des Grades der Behinderung, bei der die Auswirkungen der Funktionsbeeinträchtigungen auf die Erwerbsfähigkeit im Vordergrund stehen (siehe dazu das hg. Erkenntnis vom 20. März 2001, Zl. 2000/11/0321). Sofern nicht die Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel auf Grund der Art und der Schwere der Gesundheitsschädigung auf der Hand liegt, bedarf es in einem Verfahren über einen Antrag auf Vornahme der Zusatzeintragung ‚Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel wegen dauernder Gesundheitsschädigung‘ regelmäßig eines ärztlichen Sachverständigengutachtens, in dem die dauernde Gesundheitsschädigung und ihre Auswirkungen auf die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel in nachvollziehbarer Weise dargestellt werden.“
| Förderungen, die im Zusammenhang mit der Suche nach einem Arbeitsplatz bzw. mit dem Antritt oder der Ausübung einer Erwerbstätigkeit stehen, können begünstigten Behinderten in folgenden Fällen gewährt werden: | |
| 4.2 | für ein Orientierungs- und Mobilitätstraining, |
| 4.3 | zur Anschaffung eines Blindenführhundes, |
| 4.4 | Mobilitätshilfen: Fahrtkostenzuschüsse |
| 4.5 | Mobilitätszuschuß |
| 4.6 | Mobilitätshilfen: Förderung zur Erlangung des Führerscheines |
| 4.7 | Mobilitätshilfen: Zuschuß zum Erwerb eines Kraftfahrzeuges |
| 4.8 | Mobilitätshilfen: Sonstige Kosten |
| (Punkt 9 der Richtlinie „ Individualförderungen“) | |
4.2 Orientierungs- und
Mobilitätstraining
Förderungen für ein
Orientierungs- und Mobilitätstraining sowie für ein Training
zur Erlangung von Kommunikations- und lebenspraktischen
Fähigkeiten können begünstigten Behinderten und
Gleichgestellten gewährt werden,
sofern sie zum Antritt oder zur Ausübung einer
Erwerbstätigkeit solcher Schulungsmaßnahmen
bedürfen (Punkt 9.1 der Richtlinie „
Individualförderungen“).
Antrag auf Gewährung eines Orientierungs- und Mobilitätstrainings
4.3 Anschaffung eines
Blindenführhundes
Förderungen zur Anschaffung eines Blindenführhundes
können nur begünstigte Behinderte und ihnen
Gleichgestellte erhalten, die blind
oder so schwer sehbehindert sind, daß sie für die
Ausübung einer Erwerbstätigkeit zur Erhöhung
ihrer Mobilität eines Blindenführhundes
bedürfen (Punkt 9.2. der Richtlinie „
Individualförderungen“).
Zur Beurteilung und zur Förderung der Anschaffung von Assistenzhunden (das sind Blindenführ-, Service- und Signalhunde) hat das Sozialministerium eine Richtlinie (GZ: BMASK-44.301/0075-IV/A/7/2014 vom 1.1.2015) erlassen.
Für die Gewährung einer Förderung ist eine positive Beurteilung im Sinne der Richtlinien gemäß § 39a BBG erforderlich: „Voraussetzung für die Bezeichnung als ‚Assistenzhund‘ und für den Blindenführhund auch hinsichtlich der Gewährung einer finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln zu dessen Anschaffung ist die positive Beurteilung durch ein gemeinsames Gutachten von Sachverständigen, zu denen jedenfalls eine Person mit Behinderung gehören muss, die selber einen Hund in dem jeweiligen bzw. in einem ähnlichen Einsatzbereich nutzt. Bei dieser Beurteilung ist vor allem auf Gesundheit, Sozial- und Umweltverhalten, Unterordnung, spezifische Hilfeleistungen im jeweiligen Einsatzbereich sowie auf das funktionierende Zusammenspiel des Menschen mit Behinderung mit dem Hund Bedacht zu nehmen.“
Für die Anerkennung als Assistenzhund im Sinne des § 39a BBG, die Eintragung in den Behindertenpass und eine Förderung aus öffentlichen Mitteln ist ein positiv abgeschlossenes Beurteilungsverfahren (Qualitäts- und Teambeurteilung) Voraussetzung. Weitere Voraussetzung für die Anerkennung als Assistenzhund ist das Vorliegen einer Verpflichtungserklärung des Hundeführers/der Hundeführerin, an einer Maßnahme zur Qualitätssicherung teilzunehmen. Voraussetzung für die Zuerkennung einer Förderung ist das Vorliegen einer vertraglichen Verpflichtung der ausbildenden Einrichtung zur Qualitätssicherung.
Die maximale Zuschußhöhe beträgt das 85-fache der Ausgleichstaxe (für Unternehmen mit 25 bis 99 Mitarbeitern). Im Jahr 2017 beträgt der maximale Zuschuß daher 253 * 85 = 21.505 EUR.
Antrag auf Gewährung einer Förderung zur Anschaffung eines Blindenführhundes
4.4 Fahrtkostenzuschüsse
(allgemein):
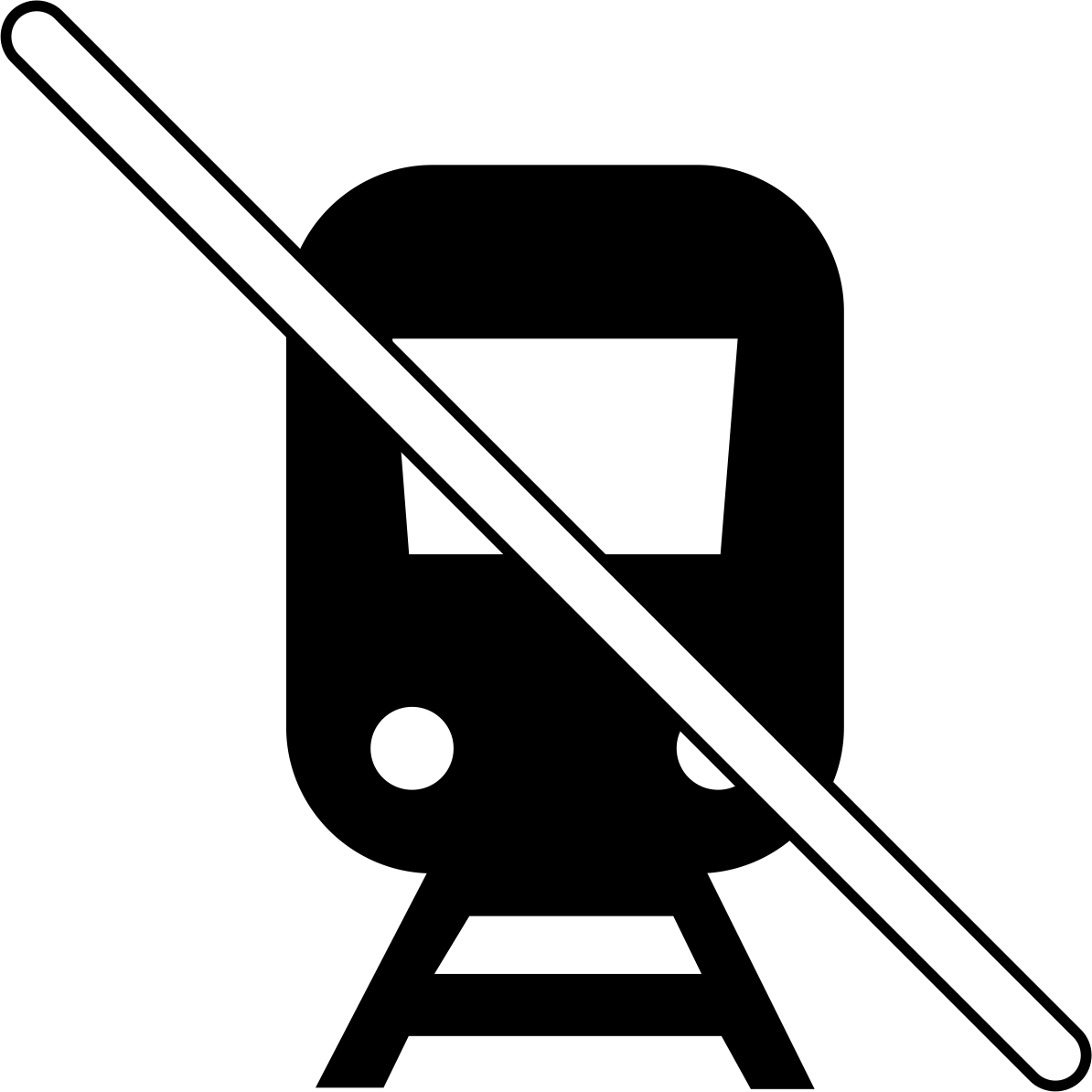 Zuschüsse zu den Kosten, die mit der Suche nach
einem Arbeitsplatz bzw. mit dem Antritt oder der Ausübung einer
Erwerbstätigkeit verbunden sind, können begünstigte
Behindete und Gleichgestellte mit einem Grad
der Behinderung von mindestens 50 % erhalten, wenn ihnen aus
behinderungsbedingten Gründen die Benützung öffentlicher
Verkehrsmittel nicht zumutbar ist. Die
Unzumutbarkeit der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist
durch eine entsprechende Eintragung im Behindertenpaß
nachzuweisen (Punkt 9.3.1 der Richtlinie „
Individualförderungen“).
Zuschüsse zu den Kosten, die mit der Suche nach
einem Arbeitsplatz bzw. mit dem Antritt oder der Ausübung einer
Erwerbstätigkeit verbunden sind, können begünstigte
Behindete und Gleichgestellte mit einem Grad
der Behinderung von mindestens 50 % erhalten, wenn ihnen aus
behinderungsbedingten Gründen die Benützung öffentlicher
Verkehrsmittel nicht zumutbar ist. Die
Unzumutbarkeit der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist
durch eine entsprechende Eintragung im Behindertenpaß
nachzuweisen (Punkt 9.3.1 der Richtlinie „
Individualförderungen“).
4.5 Mobilitätszuschuß: Der Mobilitätszuschuß ist eine Pauschalabgeltung des behinderungsbedingten Mehraufwandes im Zusammenhang mit der Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel. Der Mehraufwand muß im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stehen. Der Mobilitätszuschuß wird nur begünstigten Behinderten gewährt. Bei ausschließlichem Pensionsbezug wird kein Mobilitätszuschuß gewährt. (Punkt 9.3.2 der Richtlinie „Individualförderungen“)
Die Richtlinie „Individualförderungen“ bestimmt in Punkt 9.3.2 Abs. 1, daß der Mobilitätszuschuß einmal jährlich in der dreieinhalbfachen Höhe der Ausgleichstaxe gewährt werden kann. Im Jahr 2017 wäre die maximale Zuschußhöhe daher 253 * 3,5 = 885,50 EUR. Allerdings wird auf der Homepage des Sozialministeriumservice eine (seit 2011 unveränderte) maximale Zuschußhöhe von nur 580 EUR angegeben.
Antragsformular für einen Mobilitätszuschuß
4.6 Mobilitätshilfen: Förderung
zur Erlangung des Führerscheines:
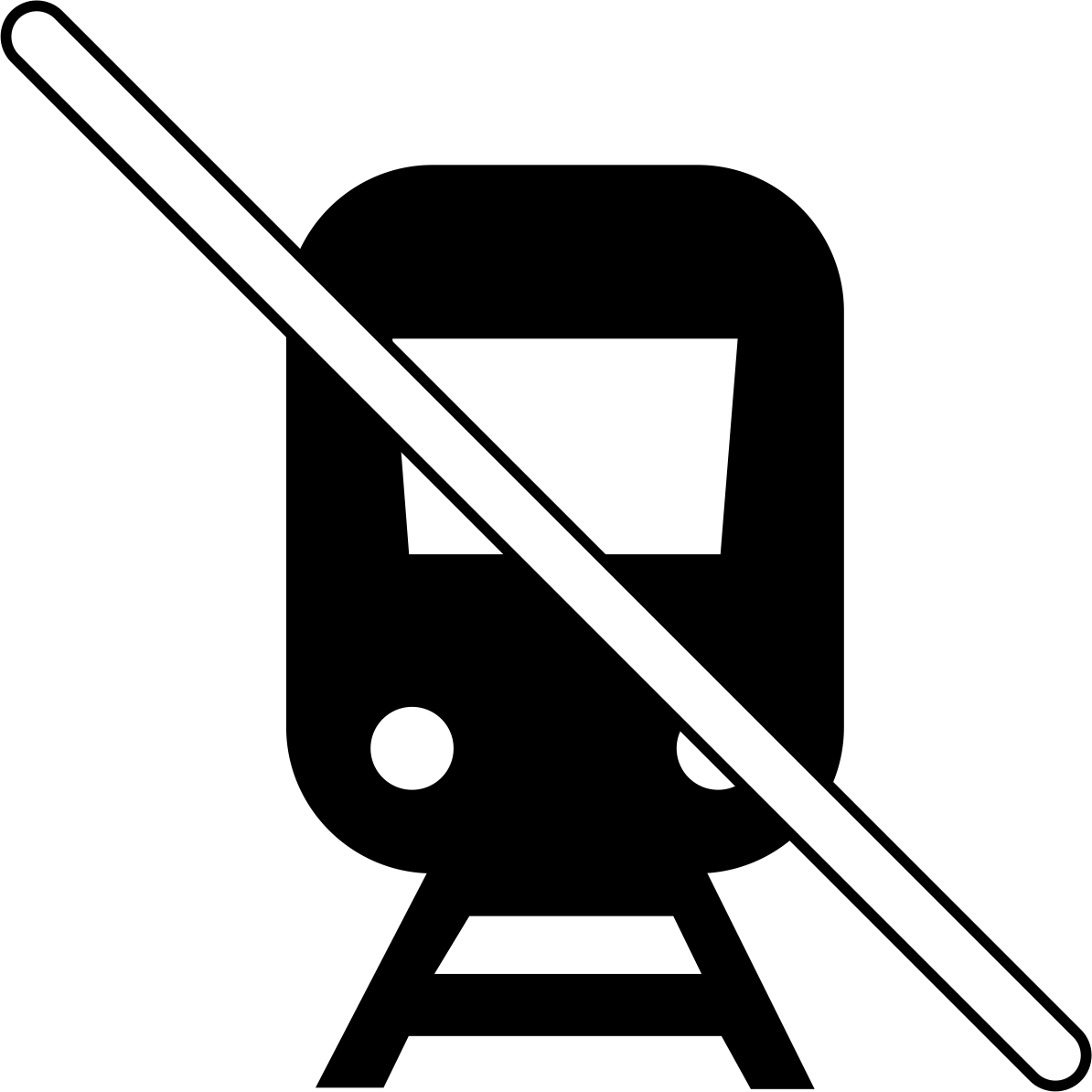 Ist die Erreichung des Arbeitsplatzes einem Behinderten
nur unter Benützung eines Kraftfahrzeuges möglich, kann zur
Erlangung der Lenkerberechtigung ein Zuschuß gewährt werden. Dieser
Zuschuß wird höchstens in der Höhe von 50 Prozent
der dafür anfallenden Kosten gewährt.
Ist die Erreichung des Arbeitsplatzes einem Behinderten
nur unter Benützung eines Kraftfahrzeuges möglich, kann zur
Erlangung der Lenkerberechtigung ein Zuschuß gewährt werden. Dieser
Zuschuß wird höchstens in der Höhe von 50 Prozent
der dafür anfallenden Kosten gewährt.
Der Zuschuß wird nur begünstigten Behinderten gewährt,
denen die Benützung öffentlicher
Verkehrsmittel nicht zumutbar ist.
4.7 Mobilitätshilfen: Zuschuß
zum Erwerb eines Kraftfahrzeuges (Punkt 9.3.4 der Richtlinie
„Individualförderungen“):
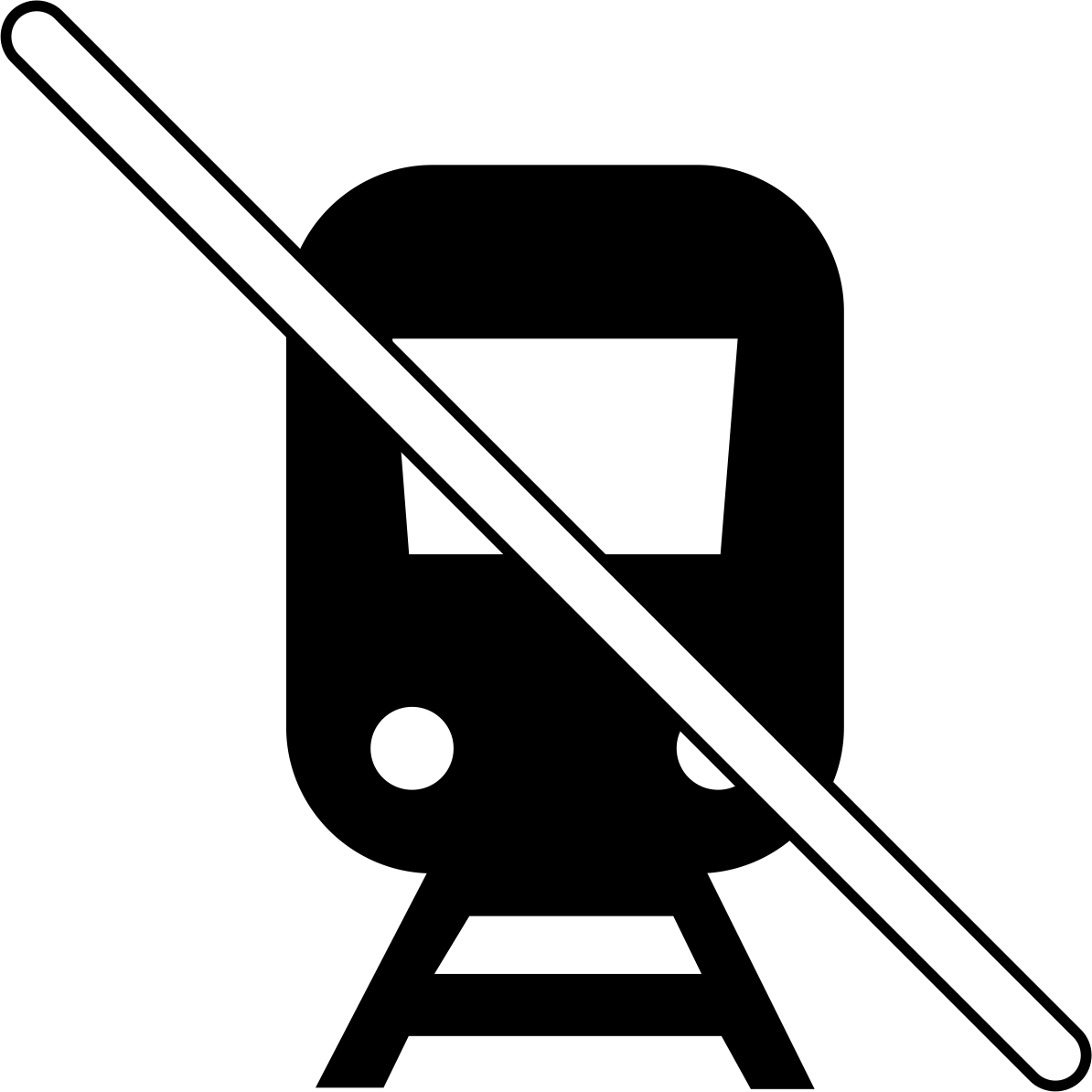 Auch dieser Zuschuß wird nur begünstigten
Behinderten gewährt, denen die Benutzung
öffentlicher Verkehrsmittel nicht zumutbar ist. Außerdem
muß der Antragsteller berechtigt sein, ein Kraftfahrzeug selbst
zu lenken, sofern die Rechnung sowie der Zulassungschein auf den Namen
des Zuschusswerbers lauten. Vom Erfordernis der Lenkerberechtigung kann
abgesehen werden, wenn ein Zuschusswerber aus behinderungs- oder
altersbedingten Gründen keine Lenkerberechtigung erwerben kann.
In diesen Fällen kann ein Zuschuss nur gewährt werden, wenn
mit dem Kraftfahrzeug überwiegend die für den Menschen mit
Behinderung notwendigen Fahrten durchgeführt werden (Punkt 9.3.4 Abs. 3
der Richtlinie „Indivdualförderungen“).
Auch dieser Zuschuß wird nur begünstigten
Behinderten gewährt, denen die Benutzung
öffentlicher Verkehrsmittel nicht zumutbar ist. Außerdem
muß der Antragsteller berechtigt sein, ein Kraftfahrzeug selbst
zu lenken, sofern die Rechnung sowie der Zulassungschein auf den Namen
des Zuschusswerbers lauten. Vom Erfordernis der Lenkerberechtigung kann
abgesehen werden, wenn ein Zuschusswerber aus behinderungs- oder
altersbedingten Gründen keine Lenkerberechtigung erwerben kann.
In diesen Fällen kann ein Zuschuss nur gewährt werden, wenn
mit dem Kraftfahrzeug überwiegend die für den Menschen mit
Behinderung notwendigen Fahrten durchgeführt werden (Punkt 9.3.4 Abs. 3
der Richtlinie „Indivdualförderungen“).
Wenn das Einkommen des Antragstellers die Höhe der zwölffachen Ausgleichstaxe nicht überschreitet (im Jahr 2017 sind das 253 × 12 = 3.036 EUR) und der Bruttokaufpreis das 150-fache der Ausgleichstaxe (im Jahr 2017 sind das 253 × 150 = 52.950 EUR) nicht überschreitet, kann ein Zuschuß zum Erwerb eines Kraftfahrzeuges gewährt. Die Einkommensgrenze erhöht sich für jede Person, für die der Antragsteller sorgepflichtig ist, um zehn Prozent.
Kosten für eine behinderungsgerechte Ausstattung oder einen behinderungsgerechten Umbau des Kraftfahrzeuges sind in das Kaufpreislimit nicht einzurechnen. Kosten für eine behinderungsgerechte Ausstattung oder einen behinderungsgerechten Umbau können bis zur Gänze übernommen werden, auch wenn die Einkommensgrenze (nach dem vorigen Absatz) überschritten ist. Bei der Gewährung einer Förderung für behinderungsgerechte Zusatzkosten ist auf die Preisangemessenheit, Wirtschaftlichkeit und ergonomische Zweckmäßigkeit der gewählten Ausstattungs- oder Umbaulösung sowie auf die Kostenbeteiligung anderer Rehabilitationsträger Bedacht zu nehmen.
| Das Einkommen ist nach Punkt 12.2 der Richtlinie „ Individualförderungen“ unter „sinngemäßer Anwendung von § 13 des Kriegsopferversorgungsgesetzes (KOVG 1957)“ zu prüfen. Dort heißt es in den Absätzen 1 bis 3: | ||
| § 13 | (1) | Unter Einkommen im Sinne des § 12 Abs. 2 ist - abgesehen von den Sonderbestimmungen der Abs. 4 und 5 - die Wertsumme zu verstehen, die einer Person aus dauernden Ertragsquellen in Geld- oder Güterform zufließt und die sie verbrauchen kann, ohne daß ihr Vermögen geschmälert wird. Zum Einkommen zählen jedoch nicht Familienbeihilfen, Erziehungsbeiträge sowie die für Kinder gewährten Familienzulagen, Familienzuschläge, Steigerungsbeträge und sonstigen gleichartigen Leistungen. Wenn das Einkommen aus einer Pension, einer Rente, einem Gehalt oder einem sonstigen gleichartigen Bezug besteht, gelten auch die zu diesen Bezügen geleisteten Sonderzahlungen nicht als Einkommen. |
| (2) | Zum Einkommen im Sinne der Abs. 1, 5 und 6 zählen bei Verheirateten 30 Prozent des Einkommens des im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten. Bei der Berechnung des Einkommens haben jedoch eine von dem im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten nach diesem Bundesgesetz bezogene Grundrente und Schwerstbeschädigtenzulage außer Betracht zu bleiben. | |
| (3) | Bei schwankendem Einkommen gilt ein Zwölftel des innerhalb eines Kalenderjahres erzielten Einkommens (Abs. 1) als monatliches Einkommen. Über den Anspruch auf Gewährung einer vom Einkommen abhängigen Versorgungsleistung ist jeweils für ein Kalenderjahr im nachhinein zu entscheiden. | |
Die maximale Zuschußhöhe beträgt das Neunfache der Ausgleichstaxe, im Jahr 2017 also 253 × 9 = 2.277 EUR. Dieser Zuschuß kann um den für die behindertengerechte Ausstattung des Fahrzeuges anfallenden Betrag erhöht werden.
Der Zuschuß wird einmal innerhalb eines Zeitraumes von fünf gewährt. Er kann wiederholt gewährt werden, beträgt aber ab dem zweiten Mal nur noch das Sechsfache der Ausgleichstaxe. Bei unbrauchbar oder wirtschaftlich nicht mehr reparierbaren Fahrzeugen kann der Zuschuß bereits vor dem Ablauf der Fünfjahresfrist gewährt werden.
Bei Anschaffungen im Rahmen eines Leasingvertrages kann für die Dauer des Leasingverhältnisses, maximal aber für die Dauer von drei Jahren, ein jährlicher Zuschuß in der Höhe der dreifachen Ausgleichstaxe gewährt werden (im Jahr 2017 also 253 × 3 = 759 EUR). Dieser Zuschuß kann um den Betrag einer aus der behindertengerechte Ausstattung des Kraftfahrzeuges resultierenden Differenz zur marktüblichen Leasingrate erhöht werden.
Bei Leasingverträgen wird der Zuschuß ebenfalls einmal innerhalb von fünf Jahren gewährt. Bei wiederholter Gewährung beträgt er höchstens nur noch das zweifache der Ausgleichstaxe.
Antragsformular für Adaptierung oder Anschaffung eines Kraftfahrzeuges
Auch die Pensionsversicherungsanstalt kann im Rahmen der beruflichen und sozialen Maßnahmen zur Rehabilitation Behinderten ein zinsenfreies Darlehen zum Ankauf bzw. zur Adaptierung eines Personenkraftwagens gewähren. Einzelheiten dazu findet man in der Broschüre Berufliche und soziale Maßnahmen der Rehabilitation (Stand 1.1.2017) auf den Seiten 12 bis 13.
Dasselbe gilt auch für die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), die das in Richtlinien für die Gewährung von beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation (RLL 2017) im Kap. 7.3, S. 22, erwähnt.
4.8 Mobilitätshilfen: Sonstige
Kosten (Punkt 9.4 der Richtlinie „
Individualförderungen“):
Behinderten können für von ihnen zu tragende
Mehraufwendungen, die im Zusammenhang mit der Fahrt von und zum
Arbeitsplatz oder im Zusammenhang mit der Ausübung der
Beschäftigung stehen, Zuschüsse gewährt werden.
Als Mehraufwendungen sind nur jene anzusehen, die über die üblichen Beförderungskosten hinausgehen und die nicht durch andere zweckgebundene Zuwendungen abgedeckt werden.
Nach Punkt 9.5 der Richtlinie „ Individualförderungen“ können Dolmetschkosten für qualifizierte Gebärdensprachdolmetscher/innen übernommen werden, wenn diese Förderung der Erlangung oder Sicherung eines Arbeitsplatzes dient bzw. für berufsbezogene Schulungsmaßnahmen erforderlich ist.
| Berufsbezogene Schulungsmaßnahmen sind | |
|
|
Maßnahmen im Rahmen eines dualen Ausbildungssystems (Lehrlingsausbildung oder sonstige Ausbildung nach dem Berufsausbildungsgesetz, Ausbildung zur Krankenpflegeperson oder zur Hebamme) |
|
|
Maßnahmen der weiterführenden Berufsausbildung (z. B. Meisterprüfung) |
|
|
berufsbegleitende oder berufsvorbereitende Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und Umschulung (z. B. Staplerschein, Buchhaltungskurs, ... ) |
| Qualifiziert im Sinne der Richtlinie „Individualförderungen“ sind Gebärdensprachdolmetscher und -dolmetscherinnen, die einen Nachweis über die positive Absolvierung einer geeigneten Ausbildung vorweisen können. Geeignete Ausbildungen bzw. Nachweise in diesem Sinne sind: | |
|
|
ein positiv abgeschlossenes fünfjähriges Dolmetschstudium unter Einschluß von Gebärdensprache am Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft (ITAT) an der Universität Graz, |
|
|
die positiv abgeschlossene sechssemestrige Fachausbildung „Gebärdensprachdolmetschen“ an der Fachhochschule Linz (bis 2011 sechssemestriger Lehrgang „Fachausbildung Gebärdensprachdolmetschen“ des Landesverbandes der Gehörlosenvereine Oberösterreichs) und |
|
|
die positiv absolvierte Berufseignungsprüfung vor der Prüfungskommission an der Universität Graz, durchgeführt vom Österreichischen GebärdensprachdolmetscherInnenVerband. |
Vor der Inanspruchnahme eines Dolmetschers ist beim Bundessozialamt ein Förderansuchen samt Kostenvoranschlag einzubringen. Bei einer einmaligen Dolmetschleistung kann das Ansuchen samt Honorarnote nachträglich, spätestens jedoch sechs Monate nach der Dolmetschtätigkeit, eingebracht werden. Bei geplanter Teamdolmetschung (zwei oder mehr Dolmetscher oder Dolmetscherinnen, die sich abwechseln) ist schon vor der Inanspruchnahme das Einvernehmen mit dem Bundessozialamt herzustellen.
| Im Jahr 2014 waren folgende Honorarsätze vorgesehen: | ||
|
|
pro halbe Stunde Dolmetschtätigkeit: | 27 EUR + Mehrwertsteuer |
|
|
pro Stunde Zeitversäumnis (Wegzeiten): | 23 EUR + Mehrwertsteuer |
| Diese Sätze werden vom Sozialministerium entsprechend der Inflationsrate angepaßt. Bei längerfristigen kontinuierlichen Dolmetschleistungen (ab der 100. Stunde) erfolgt ein Abschlag von 20 Prozent (für den gesamten Betrag). | ||
Das Bundessozialamt hat eine Regelung für Dolmetschleistungen in Gebärdensprache herausgegeben, der die obigen Honorarsätze entnommen sind.
Die Arbeitsassistenz ist eine seit 1994 in § 6 Abs. 2 lit. d BEinstG verankerte Dienstleistung, welche ab 1.1.2003 den Richtlinien zur Förderung begleitender Hilfen unterlag und seit 1.1.2015 der Richtlinie NEBA – Angebote (GZ: BMASK – 44.101/0047-IV/A/6/2014) unterliegt (NEBA: NEtzwerk Berufliche Assistenz). Zu dieser Richtlinie hat das Sozialministeriumservice für die Arbeitsassistenz Umsetzungsregelungen (Version 18.22.2015) herausgegeben, das Sozialministerium hat eine Richtlinie Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz erlassen (GZ: BMASK-44.101/0105-IV/A/6/2010 vom 1.1.2011).
| Zur Umsetzung von Angeboten der Beruflichen Assistenz und im besonderen der Arbeitsassistenz können im Rahmen der Sonderrichtlinie Berufliche Integration an geeignete Einrichtungen Zuschüsse gewährt werden. Zu den Beruflichen Assistenzen zählen | |
|
|
Jugendcoaching |
|
|
Produktionsschule |
|
|
Berufsausbildungsassistenz |
|
|
Arbeitsassistenz |
|
|
Jobcoaching |
Die Arbeitsassistenz ist eine Dienstleistung für Behinderte zur
Erlangung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Sie wird Behinderten
und Gleichgestellten gewährt. Die
Voraussetzungen für die Gewährung einer Förderung und
die Bestimmungen für die Abwicklung des Verfahrens entsprechen
denjenigen der Sonderrichtlinie
Berufliche Integration (Punkt 1.7 der Richtlinie
NEBA Angebote):
Förderungen im Sinne dieser Richtlinie sind Geldzuwendungen
privatrechtlicher Art, die der Bund in Ausübung der
Privatwirtschaftsverwaltung bzw. der Ausgleichstaxfonds nach
Maszlig;gabe der vorhandenen Mittel an eine außerhalb der
Bundesverwaltung stehende natürliche oder juristische Person oder
Personengemeinschaft auf Grundlage eines privatrechtlichen
Fördervertrages für Maßnahmen zur Verbesserung der
Chancengleichheit von Frauen und Männern mit Behinderung vergibt.
Die Förderungen werden als Einzelförderungen in Form nicht
rückzahlbarer Zuschüsse gewährt.
(Punkt 5.6 der Sonderrichtlinie
Berufliche Integration)
| Nach Punkt 10 der Umsetzungsregelungen umfaßt der Aufgabenbereich der Arbeitsassistenz die individuelle Beratung und Begleitung von Erwachsenen, Jugendlichen und jungen Erwachsenen laut Zielgruppendefinition (begünstigte Behinderte und Gleichgestellten). Ziele der Tätigkeit sind Arbeits- bzw. Ausbildungsplatzfindung und Sicherung, die Prävention vor Arbeitsplatzverlust, gegebenenfalls Krisenintervention sowie die Sensibilisierung von Unternehmen und Öffentlichkeit für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung oder Benachteiligung bzw. ausgrenzungsgefährdeten Personen im Rahmen von Begleitungen, sofern dies nicht von spezifischen Angeboten abgedeckt wird. Grundsätzlich soll die Teilnahme im Rahmen der Arbeitsassistenz ein Jahr plus maximale individuelle Probezeit nicht überschreiten. | |
| Die Arbeitsassistenz ist nach folgenden drei Grundprinzipien anzulegen: | |
|
|
integrativ: „Hilfestellung bei der Suche nach einem Arbeits- oder Ausbildungsplatz“ |
|
|
präventiv: „Unterstützung bei der Sicherung von Arbeits- oder Ausbildungsplätzen |
|
|
kommunikativ: „Kompetenzdrehscheibe für Information, Beratung, Problemlösung und Krisenmanagement“ im Rahmen von konkreten Begleitungen |
| Im Punkt II.4.3 der Richtlinie NEBA – Angebote ist das folgendermaßen formuliert: | |
| Das geförderte Verhalten der Arbeitsassistenz umfasst: | |
|
|
Beratung und Begleitung von Frauen und Männern mit Behinderung zur Erlangung von Arbeitsplätzen, |
|
|
Beratung und Begleitung von Frauen und Männern mit Behinderung zur Sicherung von gefährdeten Arbeitsplätzen. |
|
|
Beratung und Begleitung von Jugendlichen mit Benachteiligungen zur Erlangung und Sicherung von Arbeits- bzw. Ausbildungsplätzen |
| Zur Erfüllung davon sind von den Arbeitsassistent/innen insbesondere auch folgende Aufgaben wahrzunehmen: | |
|
|
Begleitung und Abklärung der beruflichen Perspektiven unter Berücksichtigung der persönlichen Lebenssituation und der individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten ohne Einschränkung auf tradierte Geschlechterrollen, |
|
|
Beratung von Dienstgeber/innen und im betrieblichen Umfeld, |
|
|
In diesem Zusammenhang Zusammenarbeit mit allen Einrichtungen, Behörden und Institutionen. |
Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam machen, daß die beruflichen Assistenz durchaus daran scheitern kann, daß ein Arbeitgeber einer Assistentin oder einem Assistenten den Zugang zu seinem Betrieb verweigert, was schon aus dem Grund der Befürchtung von Betriebsspionage verständlich ist und in dem Betrieb, in dem ich zuletzt gearbeitet habe, auch tatsächlich der Fall war.
Weitere Informationen gibt es auch beim Dachverband berufliche Integration Austria („dabei“) und beim Netzwerk berufliche Assistenz.
Zuletzt aktualisiert am 11. Jänner 2017